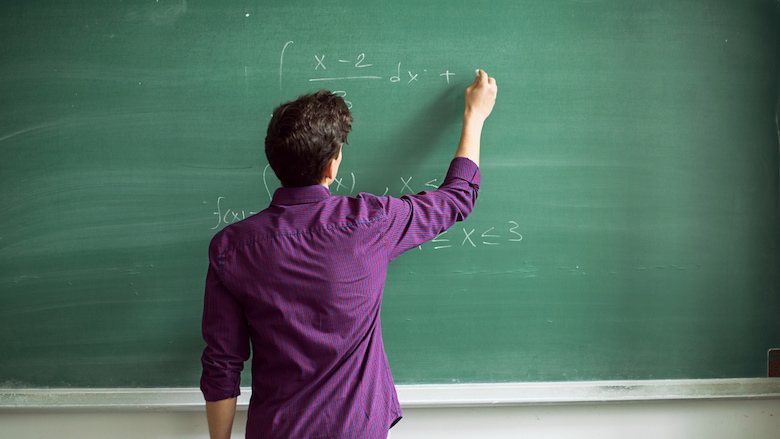Lehrer Jonas Schreiber schildert in einem Interview mit deutschen Medien eine Entwicklung, die aus seiner Sicht längst zum Alltag vieler Schulen gehört. Er berichtet, dass ein großer Teil der Jugendlichen kaum noch Interesse am Unterricht zeigt, sich nicht mit ihrer Zukunft beschäftigt und sich in dem Land, in dem sie geboren wurden, oft fremd fühlt. Die beschriebenen Entwicklungen seien deutlich spürbar und zunehmend Anlass zur Sorge. Die Website Imowell.de berichtet unter Berufung auf focus.
Schreiber sagt, dass ihm seine Arbeit weiterhin Freude bereitet, doch die Veränderungen der vergangenen Jahre ließen ihn daran zweifeln, wie lange Lehrkräfte diese Belastung noch aushalten können. Der Grund für seine wachsende Besorgnis liege im veränderten Verhalten der Schülerinnen und Schüler gegenüber dem Unterricht. Er habe sich entschieden, offen darüber zu sprechen, was tatsächlich in den Klassenräumen passiere und wie sich dies auf die Qualität der Bildung auswirke.
Der Lehrer erklärt, viele Jugendliche sagten offen, dass sie keinen Unterricht hören wollten und keinerlei Interesse an den Themen hätten. Als Beispiel nennt er eine Stunde Wirtschaft: Einige Schüler hatten ihre Präsentation nicht vorbereitet und nahmen bewusst eine schlechte Note in Kauf. Ähnliches erlebe er im Sportunterricht, wo Schüler lieber die niedrigste Bewertung akzeptierten, statt mitzuspielen oder mitzulaufen. Schreiber fragt sich, welche Konsequenzen diese Haltung für ihren weiteren Lebensweg haben werde.
Er sieht einen Zusammenhang zwischen dieser Einstellung und gesellschaftlichen Veränderungen. In manchen Fächern seien Noten für die Versetzung kaum noch relevant, und viele Jugendliche beobachteten, dass Beschäftigte mit Mindestlohn nicht viel mehr verdienen als Menschen, die staatliche Unterstützung beziehen. Dieses Bild übertrügen die Schüler auf ihre schulische Motivation: Manche äußerten, dass sie später ohnehin Sozialleistungen beziehen wollten. Laut Schreiber werde diese Haltung auch bei der beruflichen Orientierung sichtbar — viele Jugendliche beschäftigten sich kaum mit ihrer Zukunft.
Schreiber berichtet zudem von wachsenden Schwierigkeiten im Lesen. Einige Schüler seien bereits mit einem Text von drei Zeilen überfordert und hätten Probleme, den Inhalt zu erfassen. Ein Kollege habe im Deutschunterricht sogar ein Vokabelheft eingeführt, weil viele Kinder grundlegende Wörter nicht kannten. Insgesamt beschreibt Schreiber die Lage beim Lesen und Schreiben als äußerst problematisch.
Ein weiteres Thema ist die Identitätsfrage. Er erzählt von einer Schülerin mit Migrationshintergrund, die aus Angst vor einer Abschiebung zu ihm kam, obwohl sie in Deutschland geboren wurde und einen deutschen Pass besitzt. Ursache sei eine missverständliche Äußerung eines Lehrers gewesen, der Aussagen aus den Medien wiederholt habe, ohne den politischen Hintergrund mit der Klasse zu besprechen.
Schreiber betont, dass fast alle seiner Schülerinnen und Schüler in Deutschland geboren wurden und deutsche Staatsbürger sind, sich aber dennoch nicht als Deutsche sehen. Viele bezeichneten sich als Syrer, Afghanen oder Albaner, obwohl sie nie in diesen Ländern waren. Er habe mehrfach Gespräche geführt, um ihnen zu erklären, warum ihre Familien in Deutschland leben und dass sie ein Teil dieses Landes seien. In einigen Fällen hätten die Jugendlichen dadurch begonnen, sich als Deutsche mit Migrationsgeschichte zu verstehen.